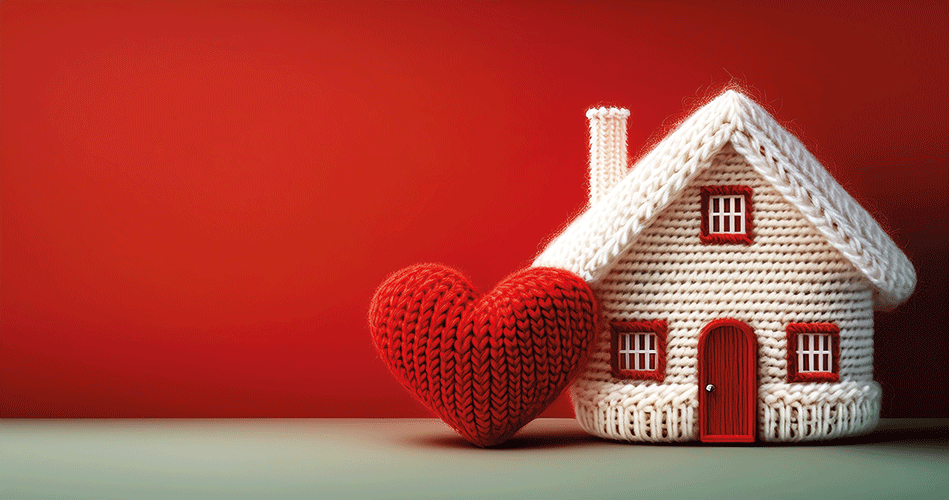 Ein Drittel der Österreicher:innen plant in den kommenden Jahren einen Umzug. © Adobe Stock/Alberto Masnovo
Ein Drittel der Österreicher:innen plant in den kommenden Jahren einen Umzug. © Adobe Stock/Alberto Masnovo
Ob Eigentum oder Miete, Wohnung oder Haus, Stadt oder Land: Studien zeigen große Unterschiede im Wohnverhalten der Österreicher:innen je nach Bundesland.
Und es gibt interessante Trends beim Thema Nachhaltigkeit.
Max ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Dieses freudige Ereignis wird von der Tatsache begleitet, dass die Wohnung in Wien für vier früher oder später zu klein sein wird. Damit gehört er zu mehr als einem Drittel der Österreicher:innen, das plant, in den nächsten zehn Jahren zu übersiedeln. Das besagt jedenfalls eine aktuelle Wohnstudie von Integral im Auftrag von Erste Bank und Sparkasse gemeinsam mit s Real. Doch jetzt stellt sich für Max und seine Familie die Frage: Mieten oder kaufen, in Wien bleiben oder raus aufs Land? Häufig hängt die Antwort auf diese Frage nicht nur allein von den persönlichen Präferenzen, sondern auch von den finanziellen Möglichkeiten ab.
Laut der Erste-Bank-Studie will nach wie vor die Mehrheit der Österreicher:innen am liebsten in Eigentum wohnen, 44 Prozent bevorzugen ein Mietverhältnis. Starke Unterschiede beim Wunsch nach Eigentum zeigen sich in den Bundesländern. Während der im Burgenland mit 77 Prozent besonders ausgeprägt ist, sind es in Wien nur 30 Prozent. „Der Immobilienmarkt in Wien unterscheidet sich deutlich vom Rest Österreichs – vor allem durch den hohen Anteil an gefördertem Wohnbau und einer traditionell starken Mietstruktur“, weiß Martina Hirsch, Geschäftsführerin von s Real Immobilien.
Und obwohl die eigenen vier Wände nach wie vor klare Favoriten sind, hat sich dieses Verhältnis im Vergleich zur letzten Studie 2023 um acht Prozentpunkte in Richtung Miete verschoben. Maximilian Clary, Privatkundenvorstand der Erste Bank Österreich, überrascht das nicht: „Viele haben aufgrund der Entwicklungen in den letzten Jahren keine Möglichkeit auf Eigentum gesehen. Die aktuell gedämpfte Verbraucherstimmung drückt natürlich nicht nur auf den täglichen Konsum, sondern auch auf die Perspektiven beim Eigentum.“
Wieso die eigene Immobilie den Österreicher:innen trotz der widrigen Umstände der letzten Jahre so wichtig bleibt, zeigen weitere Zahlen der Studie: Neun von zehn stimmen zu, dass Immobilien eine wertbeständige Anlage für die Zukunft sind. Acht von zehn sagen, dass sie in der Pension eine Sorge weniger haben, wenn die Immobilie einmal abbezahlt ist. „Immobilien zählen zu den stabilsten Formen der Altersvorsorge – sie bieten langfristige Wertentwicklung, Inflationsschutz und finanzielle Sicherheit. Wer heute in Wohneigentum investiert, legt den Grundstein für ein selbstbestimmtes Leben im Alter“, so Clary.
Unterschiede zwischen Bundesländern
Seit Jahren wohnen die durchschnittlichen Österreicher:innen konstant in Wohnungen mit vier Zimmern und einer durchschnittlichen Wohnfläche von 117 m2. Die Wohnrealität unterscheidet sich allerdings zwischen den Bundesländern deutlich.
Im Detail betrachtet, gibt es erhebliche Abweichungen, was Art, Größe und Ausstattung mit Freiflächen betrifft. Am meisten verbreitet sind jedoch Wohnflächen von 70 bis 89 m². Auf dieser Fläche lebt ein Viertel der Österreicher:innen, in Wien sogar 37 Prozent. In der Bundeshauptstadt liegt die durchschnittliche Wohnfläche mit 87 m² insgesamt weit unter dem Durchschnitt. Besonders großzügig auf über 130 m² wohnen hingegen Kärntner, Steirer und Burgenländer. Knapp darunter, aber immer noch über dem Durchschnitt, liegt man in Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg und Tirol. Das besagt zumindest eine aktuelle Trendstudie von ImmoScout24.
Während laut dieser Studie in Wien fast neun von zehn Menschen in einer Wohnung leben, zieht es die Österreicher:innen in den Bundesländern eher ins Haus. Besonders in Niederösterreich – da sind es 68 Prozent – oder im Burgenland mit 63 Prozent überwiegt das Eigenheim, in Tirol halten sich Wohnung und Haus die Waage. Österreichweit besitzen 57 Prozent der Befragten eine eigene Immobilie, Spitzenreiter ist Tirol mit 73 Prozent. Ganz anders Wien: Dort dominiert die Miete – 37 Prozent wohnen im freien Mietmarkt, weitere 40 Prozent in Genossenschafts- oder Gemeindewohnungen. Nur knapp ein Viertel verfügt über Eigentum. Auch in Vorarlberg wird überdurchschnittlich viel gemietet.
Spannend ist zudem der Blick auf die Wohnlage: Die klassische Stadtlage verliert deutlich an Beliebtheit – nur noch 27 Prozent wohnen im Zentrum, 2024 waren es noch 35 Prozent. Stabil bleibt der Stadtrand, während das Umland klar gewinnt: Hier stieg der Anteil von 8 auf 12 Prozent. Freiflächen – also Balkon, Terrasse, Loggia oder Garten – sind ebenfalls begehrt. Beinahe neun von zehn Österreicher:innen verfügen an ihrem Hauptwohnsitz über die Möglichkeit, aus den eigenen Wänden heraus an die frische Luft zu kommen. Etwas mehr als die Hälfte hat einen Garten, knapp die Hälfte einen Balkon, vier von zehn haben eine Terrasse.
Was im Durchschnitt nach viel klingt, verzerrt aber das Bild: Denn während alle Hausbewohner:innen eine Freifläche haben, sind es unter den Wohnungsbewohner:innen nur etwas mehr als drei Viertel, unter Mieter:innen nur 75 Prozent, in Stadtlage nur 72 Prozent, in Wien gar nur 70 Prozent. Doch diese Freiflächen haben ihren Preis, sagt Laurenz Lindenberger, Geschäftsführer von Lind Immobilien (siehe auch ganzes Interview auf Seite 19): „Wir sprechen von Preisunterschieden von 1.000 bis 1.500 Euro pro Quadratmeter. Ein Beispiel: Eine Wohnung kostet ohne Freifläche 6.000 Euro pro Quadratmeter, mit Balkon sind es 7.500 Euro. Bei 100 Quadratmetern reden wir über 150.000 Euro Aufpreis – nur für den Balkon.“
Guter Vorsatz: Grünes Wohnen
Der Wunsch nach einem grüneren Leben ist auch da, wenn es um ein umweltfreundliches Wohnumfeld geht. Zumindest sagen immerhin 86 Prozent der Österreicher:innen, dass ihnen dieses Thema zumindest ein Stück weit am Herzen liegt. „Für die Umwelt ist es eine sehr gute Nachricht, dass den Menschen in Österreich Nachhaltigkeit bei Immobilien so wichtig ist“, sagt Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben. „Es ist essenziell, hier gemeinsam Weiterentwicklungen voranzutreiben, die sie dabei unterstützen, die richtige Wahl treffen zu können. Die Energiewende ist zweifellos eine Mammutaufgabe, die ohne einen wohldurchdachten Beitrag der Immobilienwirtschaft nicht gelingen kann.“
Doch wenn es um konkrete Entscheidungen beim Wohnen geht, gerät die gute Absicht schnell ins Wanken – das zeigt jedenfalls eine aktuelle Umfrage von immowelt.at. Nur jeder Fünfte bewertet Nachhaltigkeit beim Wohnen als „sehr wichtig“. Für viele bleibt sie eher ein sympathischer Begleiter im Hinterkopf als ein echter Entscheidungsmaßstab.
Dabei macht laut einem Bericht der Vereinten Nationen der Gebäude- und Baubereich 38 Prozent der globalen CO₂-Emissionen aus (2020 Global Status Report for Buildings and Construction) – mehr als die Industrie oder der Verkehr. Ein Großteil davon entfällt auf den Betrieb von Bestandsgebäuden. Im Sektor Gebäude gab es in den vergangenen Jahren einen starken Rückgang der Treibhausgas-Emissionen, vor allem wegen der Umstellung auf klimafreundliche Heizsysteme und hoher Energiepreise. 2023 betrug der Anteil der direkten CO₂-Emissionen von Haushalten und Nicht-Haushalten am Gesamtausstoß laut Umweltbundesamt 10,6 Prozent – die indirekten CO₂-Emissionen, die bei der externen Energiebereitstellung entstehen, nicht mit einberechnet.
„Unsere Studie zeigt, dass ein Umweltbewusstsein bei vielen Österreichern auch beim Wohnen grundsätzlich vorhanden ist“, sagt Robert Wagner, Geschäftsführer von immowelt.at. Und egal, ob am Land oder in der Stadt, im eigenen Haus oder im Wohnblock: Die Unterschiede in der Bewertung nachhaltiger Wohnkriterien sind gering. Am stärksten ausgeprägt ist das Bewusstsein bei Hausbesitzern und Menschen in ländlichen Regionen. Doch insgesamt zeigt sich: Die Haltung zur Nachhaltigkeit ist breit gestreut, aber nicht besonders tief verankert.
„Viele erhoffen sich von klimafreundlichen Sanierungen allerdings vor allem finanzielle Vorteile, beispielsweise günstigere Betriebskosten. Wenn es dagegen um konkrete Zusatzkosten geht, sind die meisten eher zurückhaltend“, so Wagner. 61 Prozent der Befragten nennen niedrige Betriebskosten als wichtigen Faktor, 54 Prozent wünschen sich moderne Heizsysteme auf Basis erneuerbarer Energien und 46 Prozent legen Wert auf ein gesundes Raumklima.
Weniger im Fokus stehen dagegen abstraktere Aspekte wie die Recyclingfähigkeit von Baumaterialien oder die flexible Nutzbarkeit der Wohnräume – etwa durch veränderbare Grundrisse, Mehrfachnutzung oder spätere Anpassungen für altersgerechtes Wohnen. Und sobald konkrete Zusatzkosten ins Spiel kommen, sinkt die Bereitschaft weiter. Nur mehr 13 Prozent wären „auf jeden Fall“ bereit, mehr für klimafreundliches Wohnen zu bezahlen. Nachhaltigkeit bleibt damit häufig ein guter Vorsatz, aber selten ein handlungsleitendes Kriterium. Ein möglicher Grund für die Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach nachhaltigem Wohnen und der zugleich schwach ausgeprägten Bereitschaft, dafür Geld zu investieren, könnte der sogenannte „Attitude-Behavior-Gap“ – die Lücke zwischen nachhaltigen Absichten und tatsächlichem Verhalten – sein.
Auch in anderen Lebensbereichen zeigt sich dieser Widerspruch deutlich: Laut einer aktuellen Studie des Kompetenznetzwerks Handel geben zwar 41 Prozent der Österreicher an, dass Nachhaltigkeit ihr Konsumverhalten, etwa beim Einkaufen, beeinflusst, doch nur 28 Prozent sind bereit, dafür auf Wohlstand zu verzichten. Beim Wohnen – der größten finanziellen Entscheidung im Leben – verstärkt sich dieses Muster somit noch deutlicher. Wer sich fürs Neubauen entscheidet, kann von Anfang an nachhaltige Aspekte berücksichtigen. „Diese beginnen aber schon beim Mindset des Bauherren und beim Architekten. Nachhaltigkeit ist ein ganzheitlicher Aspekt und beruht auf vielen Stellschrauben“, sagt Nikolaus Westhausser, Architekt der StadtgutArchitekten aus Wien. Eine davon ist für ihn, Vorhandenes wenn möglich zu erhalten und weiter zu nutzen. „Denn jede Bestandskonstruktion hat ein hohes Maß an gebundenem CO₂. Alles was wiederverwendet werden kann, dafür muss kein neues CO₂ in Rechnung gestellt werden. Das ist ein entscheidender Punkt.“
Aber natürlich müsse der Erhalt auch praktikabel, zumutbar und finanzierbar sein. Wichtig ist für Westhausser auch das Thema Flexibilität: „Die Planung sollte so flexibel sein, dass sie möglichst viele Nutzungsszenarien und Lebenssituationen der Auftraggeber berücksichtigt. Nachträgliche Änderungen sind immer kostspielig.“ Erst wenn diese komplexen Überlegungen abgeschlossen sind, könne man sich über nachhaltige – vor allen natürlich nachwachsende – Roh- und Baustoffe Gedanken machen.
Gute Auslastung bei Fertigteilhäusern
Wer nicht selbst Ziegel für Ziegel in die Hand nehmen will, entscheidet sich gerne für ein Fertigteilhaus. Und das haben im letzten Jahr wieder mehr Menschen in Österreich gemacht. Die Anzahl der verkauften Häuser erhöht sich um 16,5 Prozent gegenüber 2023. Dadurch klettert die Fertighausquote von 14,8 auf 24 Prozent. Und der Trend setzt sich weiter fort. Der österreichische Fertighaushersteller Hartl Haus zieht zur Jahresmitte eine gute Bilanz: Mit der Verdoppelung der Stückzahlen zum Vorjahr liegt das Unternehmen auf sehr gutem Kurs
„Die stagnierenden Zinsen und das zumindest offizielle Ende der KIM-Verordnung bringen frischen Wind in die Branche. Wir sind froh, dass die Regierung gerade das Ende der KIM-Verordnung, für das die gesamte Baubranche stark gekämpft hat, so rasch umgesetzt hat“, zeigt sich Yves Suter, Geschäftsführer von Hartl Haus, erfreut. „Der Traum vom eigenen Haus lebt – und wir spüren das ganz konkret: Unser Auftragsstand reicht bereits wieder über ein Jahr hinaus.“
Die Rahmenbedingungen der vergangenen Jahre schlagen sich mittlerweile im Bauzeitpunkt und in den Kundenanforderungen nieder: Während 2011 das Durchschnittsalter der Kund:innen noch unter 39 Jahren lag, sind die Bauherr:innen heute durchschnittlich über 41 Jahre alt. Ein Langzeitvergleich zeigt den Trend noch deutlicher: Vor 15 Jahren stellten 25- bis 44-Jährige rund 70 Prozent der Kundschaft, heute sind es rund 60 Prozent. Gleichzeitig hat sich der Anteil der 55- bis 64-Jährigen nahezu verdoppelt und liegt aktuell bei rund 16 Prozent. Auch die Wohnfläche wird wieder größer. Statt rund 132 m² geht es Richtung 139 m².
„Wer mehr Wohnfläche realisieren will, setzt sich mit den Optionen genau auseinander. Teilweise hohe Grundstückspreise rücken Zubauten zu einem späteren Zeitpunkt oder Mehrfamilienhäuser stärker in den Fokus“, weiß Suter. In der Abteilung Objektbau, die Zu- und Umbauten umsetzt, konnte bereits in den ersten sechs Monaten das Niveau des gesamten Vorjahres erreicht werden. In Gegenden mit hohen Grundstückspreisen ist zudem eine Tendenz zu Mehrfamilienhäusern erkennbar, die oft als Generationen- oder Doppelhäuser konzipiert werden.
Auch Elk geht es gut. Der Fertighaus-Hersteller verzeichnet in Deutschland ein deutliches Plus und konnte mit der Eröffnung des Elk Experience Centers in Prag einen erfolgreichen Markteintritt in Tschechien feiern. Außerdem wurde im Werk in Schrems auf Zweischichtbetrieb umgestellt, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Gleichzeitig wird der Standort Schrems langfristig mit zusätzlichen Arbeitsplätzen gestärkt.
Max zieht aufs Land
Und was machen nun Max und seine Familie? Sie haben sich – mit etwas Unterstützung der Eltern – für ein Grundstück in Niederösterreich entschieden. Demnächst fällt der Startschuss für ihr eigenes Häuschen im Grünen. Damit folgt Max einem Weg, den viele Österreicher:innen einschlagen: raus aus der Stadt, hinein ins Eigentum und näher zur Natur. Seine Entscheidung zeigt, wie sehr persönliche Lebenssituationen, finanzielle Möglichkeiten und gesellschaftliche Trends ineinandergreifen – und wie der Traum vom Eigenheim trotz aller Herausforderungen weiterlebt. (BS)
EIN GESPRÄCH
mit Laurenz Lindenberger, Geschäftsführer von Lind Immobilien
Gibt es eine einfache Antwort auf die Frage: Wie wohnen die Österreicher:innen?
Laurenz Lindenberger: Wohnen ist sehr subjektiv, die Vorstellungen sind ganz unterschiedlich. Aber es gibt Schnittpunkte: Wohnen muss leistbar sein, und dafür sind die Menschen bereit, Geld auszugeben – quer durch alle Gesellschaftsschichten. Man sieht auch ein klares Stadt-Land-Gefälle. In Wien, wo der Anteil an Mietobjekten sehr hoch ist, haben wir eine starke Durchlaufquote bei Mieten. Bei uns entfallen etwa zwei Drittel der Arbeit auf Mietobjekte und nur ein Drittel auf Eigentum – das spiegelt den Wiener Immobilienmarkt sehr gut wider. Geht man in den Speckgürtel oder in die Bundesländer, ist Eigentum viel stärker vertreten.
Woran liegt das? Gibt es in Wien zu wenig Eigentumswohnungen oder sind sie zu teuer?
Lindenberger: Beides. In Wien braucht man mehr Kapital, man muss einfach finanzkräftiger sein. Gleichzeitig ist der Traum vom Häuschen am Land mit Garten noch in vielen Köpfen verankert. Die Mietwohnung in Wien ist daher oft ein Zwischenschritt. Aber der wichtigste Punkt in ganz Österreich bleibt: Leistbarkeit. Die Menschen sind bereit, Geld auszugeben, aber es muss Qualität geboten werden. Vor allem Freiflächen sind ein großes Thema – Balkon, Terrasse, Loggia, Garten. Die Pandemie hat diesen Wunsch noch verstärkt.
Also Wohnungen mit Freiflächen werden schneller vermietet oder verkauft?
Lindenberger: Ja, ganz klar. Im Eigentum sogar drastisch. Da sprechen wir von Preisunterschieden von 1.000 bis 1.500 Euro pro Quadratmeter. Ein Beispiel: Eine Wohnung kostet ohne Freifläche 6.000 Euro pro Quadratmeter, mit Balkon sind es 7.500 Euro. Bei 100 Quadratmetern reden wir über 150.000 Euro Aufpreis – nur für den Balkon. Bei Mieten spielt es auch eine Rolle, aber in Wien weniger, weil der Markt so angespannt ist.
Gilt das für alle Segmente – Eigentum, Mietwohnungen, sozialer Wohnbau?
Lindenberger: Im Prinzip ja. Es ist von allem zu wenig da. Je günstiger, desto größer die Nachfrage. Bei hochpreisigen Objekten nimmt die Nachfrage ab, bei Eigentum ist es ähnlich. Vor allem im mittleren Segment – zwischen 250.000 und 750.000 Euro – wird es schwierig. Da trifft es die Mittelschicht, die sich das oft nicht mehr leisten kann. Und die strengen Kreditvergaberichtlinien (KIM) haben die Lage nicht verbessert. Auch wenn die KIM-Regeln inzwischen gelockert wurden, sind die Banken intern weiterhin sehr vorsichtig.
Viele sehen Wohnungen auch als Investment, Stichwort Vorsorgewohnungen.
Lindenberger: Das war früher ein sehr gefragtes Investment. Mit den steigenden Zinsen hat das aber stark nachgelassen. Reine Anlegerwohnungen rechnen sich heute nicht mehr, viele Investoren stecken ihr Geld lieber woanders hinein.