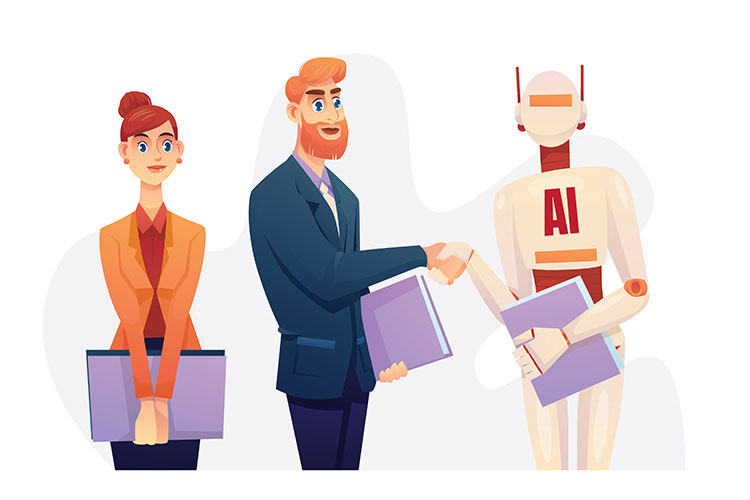 Organisationen müssen über die „Experimentierphase“ hinausgehen und KI mit definierten KPIs in Kernprozesse integrieren. © Freepik/johnstocker
Organisationen müssen über die „Experimentierphase“ hinausgehen und KI mit definierten KPIs in Kernprozesse integrieren. © Freepik/johnstocker
Während die KI-Investitionen explodieren, scheitern bis zu 85 Prozent aller KI-Projekte – ein systemisches Versagen, das nicht durch die Technologie ...
... sondern durch fehlende strategische Weitsicht bedingt ist. Doch daran kann man arbeiten.
In den Vorstandsetagen herrscht Goldgräberstimmung. Die Nutzung von künstlicher Intelligenz explodiert in vielen Organisationen. Doch während Unternehmen ihre Hardware-Ausgaben für KI-Implementierungen immer weiter steigern, können viele Führungskräfte noch immer keinen messbaren Return auf das KI-Investment vorweisen: Zwischen 70 und 85 Prozent aller KI-Projekte scheitern, bevor sie die Produktionsreife erreichen.
Gartner-Studien zeigen, dass nur 48 Prozent der KI-Projekte überhaupt die Produktionsreife erreichen – und selbst dann dauert der Übergang vom Prototyp zur Bereitstellung durchschnittlich acht Monate. Angetrieben von überzogenen Erwartungen stürzen sich viele Organisationen in die KI-Einführung und verbleiben dann in der Schockstarre der Ernüchterung.
Die Datenfalle
Der Kern des Problems liegt nicht in der Technologie selbst, sondern in den Fundamenten: 45 Prozent der heimischen Führungskräfte beklagen im „EY KI Readiness Check“ Probleme mit Datengenauigkeit oder -verzerrung. Weitere 42 Prozent verfügen nicht über ausreichende proprietäre Daten zur Modellanpassung. KI-Modelle sind nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert werden, bestätigt die Forschung – doch traditionelle Datenmanagement-Frameworks reichen für KI-Anforderungen nicht aus.
Die kritische Lücke zwischen traditionellem und „KI-bereitem“ Datenmanagement entpuppt sich als Hauptursache für das weitverbreitete Scheitern. KI-bereite Daten müssen spezifische Eigenschaften erfüllen: zweckdienlich, repräsentativ, dynamisch und fähig, neue Governance-Standards zu handhaben. Die meisten Unternehmen kämpfen mit einer „Datenmanagement-Schuld“ aus traditionellen Systemen, die nun durch KI-Anforderungen schonungslos offengelegt wird.
Wenn Angst Innovation blockiert
Während Technologie-Enthusiasten von Produktivitätssteigerungen träumen, sind viele Mitarbeiter von Change-Projekten eher besorgt als begeistert von KI, da sie fürchten, von KI ersetzt zu werden. Dieser Widerstand kann zu aktivem Boykott von KI-Tools führen und die erhofften Produktivitätsgewinne zunichtemachen. Gleichzeitig verschärft sich der Fachkräftemangel dramatisch:
Deutschland droht, bis 2027 etwa 70 Prozent der KI-Arbeitsplätze unbesetzt zu sehen, während in den USA 700.000 Arbeitskräfte umgeschult werden müssen. Viele Führungskräfte nennen mangelndes internes KI-Fachwissen als Haupthindernis. KI-bezogene Stellenausschreibungen stiegen in Österreich seit 2019 jährlich um 21 Prozent, die Vergütung um elf Prozent – doch qualifizierte Kandidat:innen bleiben Mangelware.
Strategie schlägt Technologie
Die Lösung liegt nicht in besserer Technologie, sondern in der Strategie. Erfolgreiche KI-Implementierung beginnt mit klaren, messbaren Geschäftszielen, bevor auch nur eine Zeile Code geschrieben wird. Innovative Ansätze, wie die KI Schmiede von ETC, setzen genau hier an – mit einem strukturierten Konzept auf drei Ebenen. Sicherheit für Mitarbeitende bildet das Fundament, gefolgt von Produkt- und Prozessinnovation und schließlich gesteigerter Produktivität.
Diese Pyramide adressiert sowohl die technischen als auch die menschlichen Aspekte der KI-Integration. Herzstück sind dabei klar definierte Jobrollen: vom Management über HR-Manager bis hin zu KI-Architekten, KI-Administratoren und KI-Entwicklern. Jede Position erhält spezifische Kompetenzziele, unterstützt durch maßgeschneiderte Trainings und optionale Zertifizierungen. So entsteht ein kohärentes Ökosystem, in dem Technologie und menschliche Expertise symbiotisch zusammenwirken.
Den Unterschied macht nicht der Algorithmus
Die Beweislage ist eindeutig: Organisationen müssen über die „Experimentierphase“ hinausgehen und KI mit definierten KPIs in Kernprozesse integrieren. Dies erfordert einen Mentalitätswandel – von KI als „Zaubermittel“ hin zum strategischen Werkzeug, das menschliche Fähigkeiten erweitert. Investitionen müssen weit über Hard- und Software hinausgehen: Talententwicklung, Weiterbildung und organisatorisches Change-Management sind kritisch.
In einer Ära, in der HR-Führungskräfte KI als dominanten Transformationstreiber identifizieren, entscheidet strategische Weitsicht über Erfolg oder Scheitern. Die Unternehmen, die heute in Strategie, Menschen und Prozesse investieren, werden morgen zu den 15 Prozent gehören, die KI erfolgreich nutzen – statt zu den 85 Prozent, die an technologischem Größenwahn scheitern. Der Unterschied liegt nicht im Algorithmus, sondern in der Strategie dahinter. (CB)
DER AUTOR
Christoph Becker ist KI-Experte und Geschäftsführer des österreichischen Bildungsanbieters ETC.
Nähere Informationen finden Sie unter www.etc.at